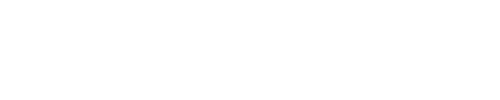Auf dieser Seite finden sie kurze Beschreibungen zu vielen wesentlichen Begriffen, die ihnen häufig im Kontext von Agilität, Scrum, Digtialte Transformation, Usability und Softwareentwicklung begegnen. Das Glossar hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit sondern soll ihnen den Einstieg in einige der essentiellen Themen erleichtern. Unterhalb der kurzen Abschnitte finden sie weitere nützliche Links zu Artikeln auf dieser Webseite in denen sie ihr Wissen vertiefen können.
Gerade keine Zeit das alles zu lesen -Damm laden sie hier gerne das Glossar als Pdf herunter. So haben sie das wesentliche immer griffbereit.
Agile / Agilität
Als Agilität im Unternehmens- und Organisationskontext wird allgemein die Fähigkeit verstanden flexibel und schnell auf Veränderungen im Markt zu reagieren und handlungsfähig zu bleiben. Das Gegenteil sind starre Unternehmensstrukturen und Prozesse, die einen Wandel verhindern. In Zeiten der Digitalisierung ist der langfristige Erfolg von Unternehmen von ihrer Fähigkeit abhängig auf die Dynamik im Markt entsprechend reagieren zu können. Hierbei hilft Agilität.
Agile Coach
Ein Agile Coach coacht Teams, Organisationen und Führungskräfte. Er unterstützt bei der Organisationsentwicklung sowie der Weiterentwicklung der Teams. Je nach Funktion nimmt er auch die Rolle des ScrumMasters im Team ein.
Akzeptanzkriterien
Akzeptanzkriterien sind schriftlich fixierte fachliche Anforderungen, die erfüllt sein müssen, damit ein Produkt oder Feature abgenommen und übergeben werden kann. Vor Allem in der Software Entwicklung kommen Akzeptanzkriterien häufig in User Stories / Jira Tickets zum Einsatz um die zu entwickelnden Software Inkremente klar zu beschreiben. Sie helfen darüber hinaus in der Qualitätssicherung sowohl Entwicklungsbegleitend als auch während der End 2 End QA Phase. Darüber hinaus dienen diese auch als Vorlage für die Erstellung von automatisierten Tests. Akzeptanzkriterien kommen vor allem im Scrum Framework zum Einsatz.
Ambidextrie
Unter Ambidextrie versteht man die Fähigkeit von Unternehmen und Organisationen effizient und flexibel zugleich zu sein.
Backend (Entwickler)
Als Backend bezeichnet man in der Softwareentwicklung die Schicht in der die Datenbank, Services und digitalen Geschäftsprozesse wie bspw. Kundenanlage, Auftragsmanagement und Billing verortet sind. Backend Entwickler kümmern sich um entsprechende Softwarelösungen in diesem Zusammenhang.
Bootstrap / Bootstrapping
Bootstrap ist zum einen ein Softwareentwicklungsframework für responsive Webseiten, dass im Wesentlichen ein Grid-System, HTML sowie CSS und Javascript beinhaltet. Dieses Framework erleichtert das erstellen von Responsiven Webseiten deutlich und senkt somit die Kosten für die Neuentwicklung von Webseiten.
Zum Anderen gibt es den Begriff im Kontext von StartUps. Bootstrapp bzw. Bootstrapping (Bootstrap – engl. Stiefelriemen) bedeutet, dass die Gründer ihr Business vollständig aus eigenen Mitteln aufbauen und keine Finanzierung oder Kapital von außen in Anspruch nehmen. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass das Primärziel ist, schnell den Break-Even und somit positiven Cashflow zu erreichen. Das Wachstum aus eigener Kraft in der Frühphase ist oft ein Pluspunkt bei der späteren Suche nach Investoren.
Bug
Der Begriff Bug wird in der Softwareentwicklung synonym für (Software-)Fehler verwendet.
Ziel ist es Fehler möglichst früh in der Softwareentwicklung zu finden um diese vor Livegang zu beheben. Neben bspw. Code Reviews gibt es sowohl Entwicklungsbegleitende Qualitätssicherung wie bspw. durch Unit- oder Integrationstests als auch durch (automatisierte) Oberflächentests die das Nutzungsverhalten simulieren um so Seiteneffekte auszuschließen.
Business Model Canvas / Lean Canvas
Der Business Model Canvas ist eine von Alexander Osterwalder entwickelte Methode zur Modellierung von Geschäftsmodellen. Das Framework ermöglicht es schnell Business Cases und deren Business Modell zu umreißen und greifbar zu machen. Eine Abwandlung des Business Model Cavas ist der Lean Canvas von Ash Maurya, der die Ansätze von Eric Ries „Lean Startup“ mit den Ansätzen von Osterwalder kombiniert.
Business Owner
Der Business Owner verantwortet ganzheitlich ein Unternehmen, ein Produkt oder ein Kundensegment. Er trifft somit alle relevanten Entscheidungen die das Business bezogen auf die Vermarktung, die strategische Weiterentwicklung und das Produkt als solches. Er ist seinerseits Auftraggeber in Richtung des Produktmanagements bzw. übernimmt diese Rolle selbst je nach Organisations-Setup.
Cross-funktionales Team
Ein Cross-funktionales Team ist in der Lage End to End Verantwortung für ein bestimmtes Feature oder ein Produkt zu übernehmen. Es besteht aus unterschiedlichen Mitgliedern, die sich in ihren Fähigkeiten ergänzen. Cross-funktionales Team wird oft auch als Synonym für agile Teams verwendet. Ein agiles, crossfunktionales Software Entwicklungsteam besteht bspw. oft aus Frontend und Backend Software Entwicklern, einem Konzepter, Designer und einem Tester. Das Team arbeitet die Businessanforderungen weitestgehend eigenständig ab und wird von einem Product Owner begleitet, der die Arbeitspakete mit dem Team definiert, priorisiert und für die Umsetzung sorgt. Je nach Setup ist auch ein Agile Coach oder Scrum Master Teil des Teams bzw. begleitet dieses in seiner Teamentwicklung.
Customer Development
Der Begriff Customer Development wurde von Steve Blank geprägt und umfasst 4 Phasen der Kundenentwicklung. Der Ansatz wird häufig von StartUps findet sich auch in Eric Ries Buch Lean Startup wieder.
Die 4 Schritte des Customer Development Prozesses:
Customer Discovery (Kunden Findung)
Customer Validation (Kunden Bestätigung)
Customer Creation
Company Building
Für Startups sind vor Allem die ersten beiden Schritte von Besonderer Bedeutung da in Ihnen die Zielgruppe definiert, eingegrenzt und validiert wird. Erst wenn die Validierungsphase abgeschlossen ist beginnt mit der Customer Creation und dem Company Building die Wachstumsphase und der Organisationsaufbau.
Customer Experience
Die Erfahrung und die Erlebnisse, die ein Kunde mit einem Unternehmen, seinen Dienstleistungen, Produkt/en oder bspw. einer Webseite hat bezeichnet man als Customer Experience (CX). Die CX eines Kunden entscheidet am Ende maßgeblich über die Zufriedenheit eines Kunden. Ein Grad der Messung der Kundenzufriedenheit, der oft heran gezogen wird ist der Sogenannte NPS (Net Promotor Score)
Customer Journey
Die Kundenreise (Customer Journey) beschriebt den Weg den ein Kunde vor seiner Kaufentscheidung geht. Bezogen auf die Nutzung einer Webseite sind dies die einzelnen Seiten, die der Kunde besucht, bis er entweder Abspringt oder kauft. Die Customer Journey ist vor Allem im Kontext der User Experience wichtig in deren Rahmen wiederum der Weg zur Kaufentscheidung bestmöglich gestaltet wird.
Customer Journey Map
In ihr wird der Weg des Kunden visuell aufgezeigt. Die Customer Journey Map ist somit ein sehr einfacher visueller weg zu verstehen und sehen welche Interaktionen ein Kunde in seiner Klickstrecke durch die Webseite vollführt. Im Zusammenspiel mit Business Analytics lassen sich so Conversion Rates im Kontext des Nutzungsverhaltens visualisieren um so wiederum Optimierungspotentiale in der Customer Journey zu entdecken und diese anschließend optimieren zu können.
Daily Standup
Das Daily Standup kurz oft Daily genannt ist eine Tägliche Terminserie oder besser ein Ritual aus dem Scrum Framework. In ihm kommt ein Crossfunktionales Team für maximal 15 Minuten zusammen um sich über den aktuellen Fortschritt der einzelnen Teammitglieder sowie deren Herausforderungen auszutauschen. Ziel dessen ist es auftretende Herausforderungen frühzeitig zu erkennen und im Team zu lösen. Sollte eine Lösung im Team nicht möglich sein so werden weitere Personen mit hinzugezogen. Wichtigster Grund ist somit ein stetiger Informationsfluss und Austausch innerhalb der Organisation zu fördern. Auch Außerhalb des Scrum Kontextes eignet sich das Daily Format gut für die Produkt-, Prozess- und Organisationsentwicklung.
Definition of Done (DoD)
Die Definition of Done (DoD) besagt, wann etwas fertig ist. Ein Teil der Definition of Done können die Aktzeptanzkriterien sein. Dies kann jedoch auch einen erfolgreichen Re-Test nach Livegang beinhalten oder eine gewisse Robustheit einer Anwendung bei Nutzung. Die DoD ist Teil des Scrum Frameworks und wird von jedem Team individuell definiert, ggf. nach Produkt oder Qualtiätsvorgaben des Unternehmens bzw. des Business oder Product Owners
Definition of Ready
Um festzulegen, wann man sinnvoll mit der Umsetzung eines Features beginnt definiert ein Team eine Definition of Ready (DoR). Diese besagt, welche Kriterien erfüllt sein müssen, bevor die Umsetzung beginnt. Sie kommt häufig in der Softwarentwicklung aber auch in der Produktion zum Einsatz und steht in enger Verbindung mit dem Kanban und Scrum-Framework. Die DoR dient vor allen Dingen dazu unnötige Arbeit, die im Kaizen oft als Waste (Müll) bezeichnet wird zu vermeiden. Letztlich geht es darum die eigentliche Anforderung so klar wie möglich zu formulieren um später Fehler, die in der Softwareentwicklung als Bugs bezeichnet werden, zu vermeiden ,als auch die gewünschten Features vollständig umgesetzt zu haben.
Design Sprint
Der Design Sprint ist ein zeitlich begrenzter Prozess, der fünf Phasen umfasst. Er soll Teams helfen auf einfache Art und Weise Ideen zu validieren und Ziele zu definieren, bevor die eigentliche Produktentwicklung startet.
Die 5 Phasen sind:
Understand / Verstehen: In dieser Phase geht es darum die Problemstellung, das Geschäftsmodell, den Wettbewerb und die Potentiellen Kunden zu verstehen. In diesem Rahmen werden auch erste Wertversprechen (Value Propositions) und Erfolgskriterien (KPIs)
Diverge / Divergieren: In der zweiten Phase geht es vor allem darum kreative Lösungsansätze zu finden und erforschen. Vielfalt ist hierbei wichtiger als einen einzelnen perfekten Ansatz zu finden. Es geht vielmehr darum möglichst viele Ansätze und Blickwinkel zu betrachten um später die besten Ideen zu konkretisieren und auszuarbeiten. Verlieren sie in dieser Phase keine Zeit darauf ihre Lösungen zu perfektionieren sondern konzentrieren sich darauf das volle kreative Potential ihres Teams auszuschöpfen.
Converge / Konvergieren: Nachdem sie sehr breit gedacht haben geht es in diesem Schritt um das Konkretisieren und Identifizieren von geeigneten Lösungsansätzen für ihre Problemstellung. Hierbei wird auch überprüft ob die Lösung für ihre Zielgruppe bzw. Persona passt. Das Storyboarding wird in diesem Kontext häufig verwendet um genauer zu Untersuchen ob die Lösungen zielführend sind.
Prototype / Prototyp entwickeln: Der Entwurf eines Prototypen findet in der vierten Phase des Desing Sprints statt. Auch hier gilt, es geht um die Funktionalität und nicht um Perfektion. Gut genug, ist gut genug! Der Prototyp soll vor allem helfen schnell wesentliche Sollbruchstellen zu identifizieren und Erkenntnisse zu gewinnen. Die Zeit des Design Sprints ist begrenzt und sollte ihnen dazu dienen möglichst viele Erkenntnisse in kurzer Zeit zu gewinnen.
Test / Testen: Im letzten Schritt wir ihr Prototyp mit 5-6 Personen aus ihrer primären Zielgruppe getestet. Hierbei ist wichtig gute Fragen zu stellen. Bswp. was würden Sie erwarten wenn sie auf folgendes Bedienelement klicken? Es geht vor allem darum zu verstehen ob ihr Kunde ihren Lösungsansatz versteht, benutzen würde und problemlos damit klar kommt. Ihnen mögen 5-6 Probanden sehr wenig vorkommen, in den meisten Fällen reichen diese jedoch vollkommen aus um die Kernprobleme ihres Protoyps aufzuzeigen.